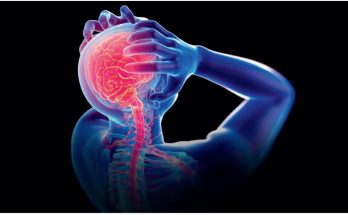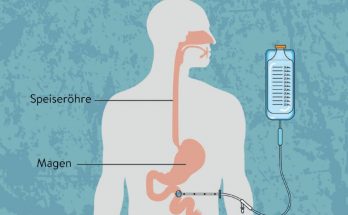Diagnose und Therapie des nicht-spezifischen Kreuzschmerzes
DFP-Fortbildung SN 3/19: Kreuzschmerz – auch geläufig unter den Begriffen unterer Rückenschmerz oder „low back pain“ – gehört zu den häufigsten Beschwerden, die zu einem Arztbesuch führen. Er verursacht enorme sozio-ökonomische Kosten.
Mehr lesen